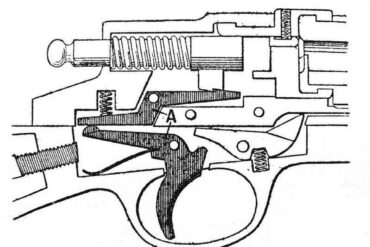Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz, der durchaus als Ikone für neue Formen von Männlichkeit gelten kann, überrascht in seiner Autobiografie Career Suicidemit einem Welt- und Menschenbild, das mit diesem Ruf nur schwer vereinbar ist. Im Vordergrund steht die Selbstinszenierung.
Von Frederik Eicks
Als 15-jähriger Frontsänger von Tokio Hotel wurde Bill Kaulitz über Nacht zum deutschlandweiten Star und gewann mit der Band national wie international dutzende Awards. Tokio Hotel polarisierten wie vermutlich keine andere Band vor oder nach ihnen. Jede:r hatte eine Meinung zur Band – selten ging es dabei um die Musik selbst, sondern vor allem um Kaulitz’ Auftreten: schwarzgefärbte Haare, dicker Kajalstrich, androgyne Gesichtszüge, schmaler Körperbau. Dass sein Geschlecht und seine Sexualität sich möglicherweise außerhalb heteronormativer und binärer Geschlechterbilder bewegten, war für viele Menschen inakzeptabel. Das hatte offenen Hass inklusive Morddrohungen zur Folge.
Dem gegenüber stand eine enorme Zahl von Die-Hard-Fans, welche die Band bei jedem Auftritt mit trommelfellzerreißendem Gekreische empfing. Einige dieser Fans wurden zu Stalker:innen, die vor dem Haus der Zwillinge Tom und Bill campierten und versuchten, einen Blick auf die beiden zu erhaschen. Nachdem bei ihnen eingebrochen wurde, zogen die Brüder nach L.A. und verschwanden für vier Jahre von der Bildfläche. Kaulitz’ Autobiografie Career Suicide. Meine ersten dreißig Jahrehat also eine Menge zu erzählen. Und über das Erzählte – insbesondere darüber, wie es erzählt wird – gibt es leider eine Menge zu sagen.
Die Biografie-Illusion
Offensichtlich handelt das Buch von Kaulitz’ Leben. Dabei widmet er sich seiner Kindheit und Jugend vor dem Durchbruch genauso ausführlich wie der Zeit danach, sodass die beiden ungleichen Lebenshälften des mittlerweile 31-Jährigen im Buch gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Kaulitz redet über die von Armut bestimmten Familienverhältnisse, von Drogenerfahrungen im Grundschulalter und den ersten wackeligen musikalischen Schritten. Den Grat zwischen Unangepasstheit und Unangemessenheit ignoriert Kaulitz dabei konsequent, sodass er sich zum Beispiel bei der Schilderung von Doktorspielen im Kindergarten an den »Ungewaschene-Muschi-Geruch« seiner Kindergartenfreundin zu erinnern meint.

Bill Kaulitz
Career Suicide
Ullstein: Berlin 2021
384 Seiten, 10,99€
Hier laufen zwei wesentliche Probleme von Career Suicide zusammen (von denen keins das gravierendste ist). Das erste Problem ist die Biografie-Illusion, dem eigenen Leben rückblickend eine thematische Kohärenz zu verleihen, die es in seiner unendlichen Komplexität einfach nicht aufweisen kann. Die Fülle von Passagen, in denen Kaulitz sein eigenes Leben gewaltig streamlinet und als konsequente Entwicklung darstellt, ist irritierend. Nein, Kinder beschließen nicht »an diesem Abend […], ebenfalls Raucher und Trinker zu werden«. Wichtigstes sinnstiftendes Element ist für Kaulitz offenbar die frühe Konfrontation mit und das Interesse an Themen, die üblicherweise erst in der Pubertät relevant werden. So geht es in etwa jeder zweiten Erinnerung um Sex, wobei in der Erzählung rückwirkend auch andere Kinder auf eine eklige Weise sexualisiert werden. Da ist zum Beispiel die bereits erwähnte, angeblich ›frühreife‹ Spielgefährtin oder eine Kindergartenfreundin seines Bruders, zu der Kaulitz folgenden Kommentar parat hat: »Tom stand schon damals auf Groupies« – mit der Begründung, dass das Mädchen seinem Bruder immer hinterhergelaufen sei, völlig klar, wie ein Groupie eben.
Diese abwertende Bezeichnung führt zum zweiten Problem: Kaulitz’ Art, über Frauen zu schreiben. »Girls« werden »ausprobiert«, »Groupies« werden »weggefickt und abgeschleppt«, eine ehemalige Lehrerin wird als »Fotze« bezeichnet und »die Musikwelt öffnete sich wie eine warme, feuchte Möse«. Weitere ungelenke rhetorische Figuren, die weibliche Genitalien involvieren, fallen auf in einer ansonsten unauffälligen, leicht zu lesenden Prosa, die allerdings vor Kitsch und Plattitüden nicht gefeit ist.
Eine Frage der Ästhetik
Und was würde besser zum floskelhaften Schreiben passen als die Vielzahl klischeebehafteter, vorurteilender Beschreibungen bis hin zu unverhohlenen Anfeindungen gegenüber allen möglichen Personengruppen? Hierin liegt das Kernproblem von Career Suicide. Kaulitz kann zurecht als deutsche Ikone für neue Formen von Männlichkeit gelten und diesem Status folgend inszeniert er sich als Advokat für die Anderen, für diejenigen, die keinen Platz in der Mehrheitsgesellschaft haben oder keinen haben wollen, wenn er seinem Buch das Motto voranstellt:
Für alle Mutigen und die, die es mal werden wollen. Für all die Unruhestifter und Rebellen. Nichts ist schwieriger, als man selbst zu sein. Traut euch!
Das Anderssein, das Kaulitz vorzuschweben scheint, ist selbst aber weder gesellschaftlich oder gar politisch zu verstehen. Für Kaulitz ist Anderssein in erster Linie eine Frage der Ästhetik: Er war früher anders, weil er feminin gelesene Outfits und Make-Up getragen hat – er ist jetzt anders, weil er in seinem »Traumhaus […] in den Bergen von Hollywood« sitzt, das gefüllt ist mit »Teppichen aus Paris, Kunst aus einem anderen Jahrhundert – indianischer Kopfschmuck gerahmt in Teak-Holz«, wie er im Prolog schreibt (natürlich gibt es einen Prolog). Dass er hier mit der Verwendung des Begriffs ›indianisch‹ auch eine homogenisierende Fremdbezeichnung für Native Americans verwendet, fügt sich nahtlos in das Bild, das Kaulitz, freiwillig oder nicht, von sich zeichnet: Die eigene Inszenierung läuft dem Ruf von Akzeptanz und Offenheit zuwider, wenn Kaulitz auch über andere Gruppen von Menschen pauschal und abwertend spricht.
Er macht sich lustig über »schrecklich alternative Familien mit […] einem strengen Familiengeruch«. Im Dorf Loitsche, in das Kaulitz mit neun Jahren zog und das er als »ländliche Inzest-Idylle« bezeichnet, leben in seiner Erzählung bis auf wenige Ausnahmen nur Messis und Alkoholiker:innen – »die allerunheimlichsten Kreaturen«. In dieser simplen Welt werden die Dreadlocks von Tom, eines weißen Jungen im Grundschulalter, schon mal »auch ein politisches Statement«, im Schulbus sind die »Heimkinder und auch der Rest von der Sonderschule […] echt gruselig […] und irgendwann waren viele von ihnen richtige Nazis«. Im »tiefsten Ghetto« von L.A. leben »nichts als […] obdachlose Crack-Süchtige, Heroinabhängige und Psychos«. Diese Reihe von Entgleisungen ließe sich beliebig lange fortsetzen, wobei es keine Passage gibt, in der das Geschilderte eingeordnet, kritisch hinterfragt oder reflektiert würde.
Das Märchen, es allein geschafft zu haben
Im Kaulitz‘schen Kosmos sind nur Nazis Rassist:innen und nur dumme, ungebildete Sonderschüler:innen sind Nazis. Hier gibt es auch keine materiellen Zwänge, die Suchtkranken und Arbeitslosen sind doch selber schuld, sie wollen ja nichts ändern. Die Sichtweise auf sein Umfeld ist stark verkürzt und absolut unzureichend, aber: Mit diesem Blick wächst Kaulitz auf. Er wird permanent angefeindet, weil er sich nicht in das Bild eines ›normalen‹ Jungen einfügt und er macht Mobbingerfahrungen, die bis zu sexueller Belästigung gehen. Dass ein Aufwachsen unter diesen Bedingungen zusätzlich zu einem Leben am Existenzminimum immens prägend für die Persönlichkeit und die eigenen Vorstellungen eines guten Lebens ist, steht außer Frage. Diese Tatsache dreht sich Kaulitz aber wieder im Sinne seiner Selbstinszenierung zurecht: Die Beschreibung der schwierigen Verhältnisse wird mit dem Narrativ verknüpft, dass die Zwillingsbrüder es aus eigener Kraft und gegen jede Wahrscheinlichkeit aus diesen Verhältnissen herausgeschafft haben.
Diese Erzählung bedienend macht das Vorwort von Benjamin von Stuckrad-Barre dem Haupttext ernsthafte Konkurrenz in der Kategorie ›Unreflektiertester Satz im ganzen Buch‹: »Vielleicht kann es wirklich jeder schaffen, von egal wo aus.« Ansonsten versucht sich das Vorwort an einem Framing, in welchem dem Buch allerlei Attribute zugeschrieben werden, die durch die Lektüre widerlegt werden: »nicht prahlerisch«, »nicht von sich selbst gerührt oder getäuscht«, »unprätentiös« und »so vollkommen uneitel«. Stuckrad-Barre frönt bereitwillig und mit spürbarer Hektik der Überhöhung von Bill Kaulitz. Einerseits wird dessen Text damit verteidigt, dass der Inhalt »nachrangig« sei und es darauf ankomme, »WIE etwas erzählt wird«, andererseits betont Stuckrad-Barre den Wahrheitscharakter: Das alles könne »nur ganz genau so auch tatsächlich gewesen sein«.
Dabei ist unschwer zu erkennen, dass Kautlitz’ Narrativ nicht aufgeht. Die zwei Brüder waren eben nicht auf sich allein gestellt. Sie hatten es schwer, konnten aber auf eine liebende, unterstützende Mutter und einen Stiefvater vertrauen, der sie musikalisch gefördert hat. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht zum Auftritt von Bill Kaulitz bei der Castingshow Star Search gekommen, der letztendlich für die Entdeckung der Band, die damals noch Devilish hieß, gesorgt hat. Darin liegt der große Unterschied zwischen den Zwillingen und all den anderen Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen und die Kaulitz allein dafür verurteilt.
And the Winner Is…
Wenn Career Suicide nach 200 Seiten schließlich bei der Entdeckung und dann der Veröffentlichung der Single Durch den Monsun ankommt und Kaulitz aus seiner Perspektive vom Phänomen Tokio Hotel erzählt, wird das Buch schlagartig besser. Er spricht offen über den wachsenden Erfolgsdruck, die soziale Isolierung und die Entwicklung einer regelrechten Menschenangst, entstanden aus dem Hass und der wahnsinnigen Vergötterung, die der Band simultan entgegenschlagen. Diese Innenansichten sind tatsächlich interessant. Kaulitz zeigt auch, dass er ein Gespür dafür hat, die Magie eines gelungenen Auftritts einzufangen, zum Beispiel bei der Beschreibung des Auftritts bei den MTV EMAs 2007. Die knapp 100 Seiten, die sich mit fünf Jahren absoluten Tokio Hotel-Höhenflugs befassen, sind mit Abstand der beste Teil des Buchs.
Dennoch bleibt Kaulitz’ Ton selbstgefällig und Personen außerhalb seines engsten Kreises gegenüber abschätzig. Besonders schmälernd ist diesbezüglich das Ende von Career Suicide. Nachdem Kaulitz sich im Verlauf des Buchs mehrmals damit brüstet, sich niemals verstellt oder es anderen recht gemacht zu haben und stattdessen stets seinen Willen durchgesetzt zu haben, interpretiert er im Epilog (natürlich gibt es einen Epilog) auch die Einwände seiner Lektorin, dass er stellenweise »arrogant und unsympathisch« wirke, als Ausdruck dieser Integrität und Durchsetzungsfähigkeit. Viel eher ist das aber einfach nur genau das: der Ausdruck von Arroganz. Denn Kaulitz könnte anders schreiben. Er könnte seine eigenen Vorurteile hinterfragen und er könnte erkennen, dass seine Darstellungsweise auf verschiedenen Ebenen hoch problematisch ist.
Ein wesentliches Hindernis hierbei ist wahrscheinlich dieses Mindset: »Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als etwas lernen zu müssen.« Und da ist er, der Gewinner in der Kategorie ›Unreflektiertester Satz im ganzen Buch‹, der zur Kür auch noch vor Ignoranz für die eigenen Privilegien strotzt. So bleibt Kaulitz’ Blick der eines frühpubertären Jungen, der in seinen ersten 30 Jahren gelernt hat, zwecks Selbstschutz auf andere herabzuschauen. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten 30 Jahren.