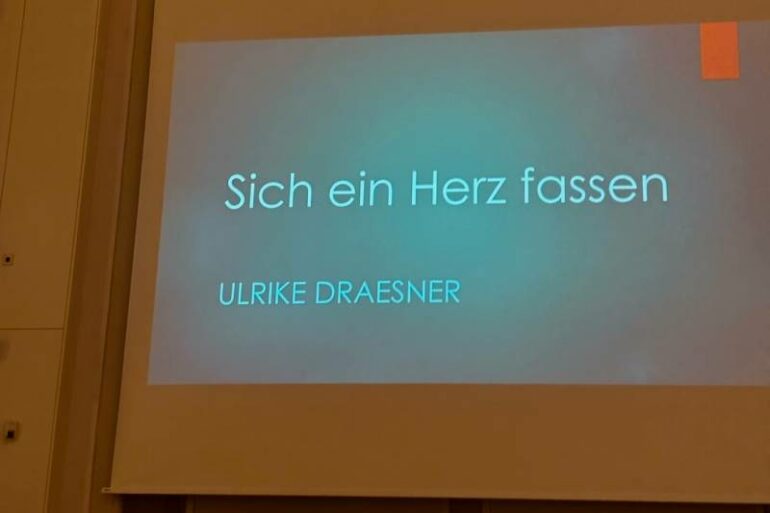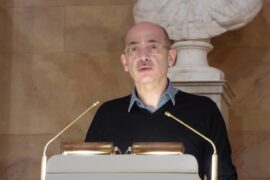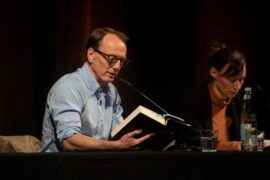Nachdem Ulrike Draesner tags zuvor über das Scheitern sprach, rückt am zweiten Abend das »Ich« ins Zentrum. In ihrem zweiten Vortrag, mit dem Titel A-U-S dem Ich, vertieft sie Überlegungen des vorigen Abends und untersucht mögliche Formen literarischer Aktualität. Im Fokus steht dabei die Frage, inwiefern es in einer Zeit, die Miteinander und Perspektivenerweiterung verlangt, möglich ist, über das gegenwärtige »Ich« hinauszugehen.
Von Sofia Peslis
Bild: Sofia Peslis
Am 7. Februar 2025 betritt Ulrike Draesner ein weiteres Mal die Bühne. Die Einführung wird von Anna-Lena Markus vom Literarischen Zentrum übernommen. Während des Vortrags wird Draesner wieder von einer PowerPoint-Präsentation begleitet, die sie von Zeit zu Zeit einsetzt, um bestimmte Aspekte ihres Vortrags zu unterstreichen. Draesners Stimme ist dabei ein Highlight: Sie klingt, wie auch schon am Vortag, warm und positiv, was das Zuhören angenehm macht. Es wird sofort deutlich, dass sie an den Ton und die Struktur des vorherigen Abends anknüpft: Der wiederholte Einsatz englischer Begriffe verleiht ihrer Rhetorik eine besondere Prägnanz, der Körper, the body, zieht sich auch diesmal wieder als Faden durch den Vortrag. Gegliedert ist der Abend in drei Abschnitte: A-U-S dem Ich, Lügen und Mythen über Autofiktion und schließlich die Zukunftsperspektive: Wird es Autofiktion auch in Zukunft noch geben? Wie am Abend zuvor hat ihr Vortrag Archipel-Struktur, doch es sind deutlich weniger Inseln, die die Zuhörenden an diesem Abend bereisen müssen.
Der erste Teil bietet eine interessante Reflexion über die Praxis des Schreibens. Ein zentraler Punkt ihrer Reflexion ist die Beziehung zwischen Autofiktion und gesellschaftlicher Identität. Draesner fragt sich, ob autofiktionale Literatur uns ein »Ich« nachliefert, dessen wir uns im realen Leben immer unsicherer werden. Sie untersuche, wie das »Ich« sich in einer medialen Welt verflüssigt, auflöst und fragmentiert wird, sei es in sozialen Medien oder in der digitalen Kommunikation. Literatur könne als Gegenraum fungieren, in dem ein solches »Ich« neu konstituiert werde – oder sich weiter verliere. Neben diesen Überlegungen werden persönliche Erfahrungen eingebracht, insbesondere von Elternschaft und Rassismus in Deutschland. Draesner betont, dass es nicht um sie selbst oder ihre Tochter gehe, sondern darum, welche Erkenntnisse sie aus diesen Erfahrungen ziehe. Sie spricht über die Gefährlichkeit und zugleich die Schönheit der Welt, über die Kraft, überwältigende Erlebnisse zuzulassen. Hier knüpft sie an die Überlegung an, inwiefern Autofiktion zur Verarbeitung von Realität beiträgt oder gar als Fluchtort dient – eben eine »real life experience«, sich wieder ein Herz zu fassen, und eine Geschichte zu erzählen, von der man glaubt, sie müsse erzählt werden.
Mythen, Erinnerung und die fluiden Erzählwelten
Zusätzlich thematisiert Draesner die Frage nach Erinnerung und Identität im Spannungsfeld gesellschaftlicher Konstruktionen. Sie reflektiert über die Möglichkeit, Erinnerung als fluide, sich verändernde Erzählung zu betrachten, die nicht nur individuelles, sondern auch kollektives Erleben formt. Sie thematisiert, wie Wahrheiten konstruiert und vermittelt werden und welchen Einfluss externe Erzählungen auf unsere Selbstwahrnehmung haben. Sie spricht über das Verlernen von Beschreibungszwecken, über das Neudenken von Zukunft als kreativen Prozess und über die soziale Funktion von Literatur als Ort der Reflexion und Neuaushandlung von Identität. Dabei arbeitet sie sich von dem Vorwurf »Der Plot ist schon da«, bis hin zu dem »Lügenparadox ohne Kreter« und »Kollektive Autofiktionalität«.
Draesner verweist auf die Kritik, dass autofiktionale Texte keine klassische narrative Konstruktion benötigen, da die erzählte Geschichte aus dem eigenen Leben stammt. Doch genau hier liegt das Spannungsfeld: Die Autorin oder der Autor muss die Realität literarisch formen, selektieren und neu anordnen, wodurch eine eigenständige Erzählstruktur entsteht. Die Verbindung von Erzählung, Raum und Erinnerung bildet eine der zentralen Achsen ihres Vortrags, die immer wieder auf das Verhältnis von individueller Erfahrung und kollektiver Geschichte verweist. Diese ausgesprochen große Insel, in der Mitte des Vortrags, zieht sich über eine ausführliche Landschaft von Auseinandersetzungen mit 13 Mythen, Lügen über und Stärken von Autofiktion. Während die Reflexionen über die Grenzen und Möglichkeiten dieses Genres zunächst anregend wirken, wird die detaillierte Aufzählung zunehmend langatmig. Zu Beginn war die PowerPoint-Präsentation außerdem noch eine nützliche Unterstützung, vor allem für humorvolle Akzente. Gegen Ende jedoch wurde sie fast nicht mehr eingesetzt. Etwas mehr visuelle Unterstützung hätte in dieser Phase geholfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, besonders als für längere Zeit keine weiteren Inhalte eingeblendet wurden.
Die Zukunft der Autofiktion
In ihren abschließenden Betrachtungen reflektiert Draesner über die transformative Kraft der Autofiktion als Möglichkeit, den eigenen Körper in Text zu »übersetzen«. Sie verbindet dies mit der Idee, dass Autofiktion als radikale Form des Selbstschreibens verstanden werden kann, die immer zwischen Identitätsauflösung und -verfestigung schwankt. Dabei hebt sie hervor, dass der Körper nicht nur als physisches, sondern auch als kulturelles und politisches Objekt betrachtet werden muss, das in autofiktionalen Texten immer wieder neu verhandelt wird. Durch das Schreiben über den Körper entsteht eine Reflexion darüber, wie dieser Körper durch gesellschaftliche Normen und Erzählungen geprägt wird, während er gleichzeitig als Ort der Selbstbestimmung und Veränderung fungiert.
Damit bleibt die Frage nach der Zukunft der Autofiktion nicht nur eine literarische, sondern auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung. In diesem Kontext interessiert Draesner, wie sich das Bild des Körpers und des Selbst in einer Welt, die zunehmend von technologischen und kulturellen Verschiebungen geprägt ist, weiterentwickeln könnte. Wird der Körper weiterhin als untrennbar mit der Identität verbunden bleiben, oder wird er sich in Zukunft in neue, entkörperlichte Formen der Selbstrepräsentation transformieren?
Selbstfindung oder KI-Illusion?
Draesner beschreibt Autofiktion als eine Form des Schreibens, die keine feste Verankerung brauche – also eine »performative Nichtbefestigung«. Sie sieht darin die Möglichkeit, Identität und Erzählung flexibel zu gestalten, anstatt sie als starre, unveränderliche Konzepte zu betrachten. Dies führt sie zur Frage der Autorität: In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz Texte generieren kann, stelle sich die Frage, worauf literarische Glaubwürdigkeit beruhe. Während früher persönliche Erfahrung als zentrales Kriterium für Autorität gegolten habe, könnten heute algorithmische Muster zunehmend diese Rolle übernehmen. Dies wiederum berühre unser Verständnis von Authentizität: Wenn Texte nicht mehr eindeutig einem individuellen Erleben entspringen, wie verändert sich dann unsere Wahrnehmung autofiktionaler Erzählungen? Dieser Abschluss über künstliche Intelligenz schlägt einen anderen, drastischeren Ton an. Draesner stellt die Frage, ob Autofiktion in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle im kreativen Prozess spiele, Bestand haben könne. Während ihre Dozentur diese Problematik aufwarf, wurde sie gleichzeitig von einer fast störend-kritischen Haltung gegenüber KI durchzogen. Schon am ersten Abend waren Seitenhiebe in diese Richtung spürbar, doch am zweiten Abend wirkten sie noch viel präsenter. Dabei schien sich die Schärfe der Kritik weniger aus einer differenzierten Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen von KI zu speisen, sondern eher aus einer Zuspitzung des Themas, die nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
Obwohl Draesners Vortrag in vielen Momenten zum Nachdenken anregt und ihre gedanklichen Inseln wieder einmal interessante Verknüpfungen herstellen, bleibt die Gewichtung der Themen unausgeglichen. Die Schlusssequenz wirkt weniger wie ein pointierter Abschluss als vielmehr wie ein bewusst gesetzter Bruch – eine Entscheidung, die Fragen nach der Rolle des »Ichs« in zukünftigen Erzählwelten offenlässt. Doch indem sie die transformative und auch brüchige Natur der Autofiktion betont, wirft Draesner einen Blick auf eine mögliche Zukunft, in der der Körper, das »Ich« und die Narrative der Selbstrepräsentation in ständiger Veränderung begriffen werden.