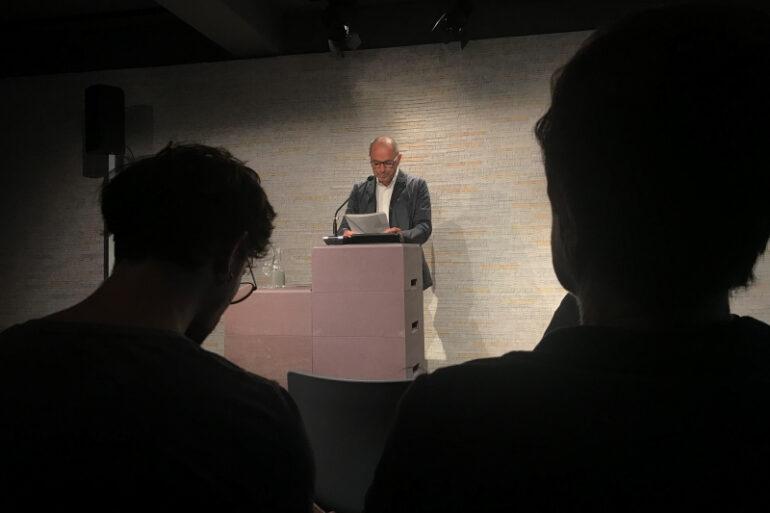In seiner ersten Poetikvorlesung spricht Norbert Gstrein über sein von der Mathematik geprägtes Schreiben, literarische Trends und die Verhältnisse zwischen Mathematischem und Literarischem, Wahrem und Trivialem. Das ist interessant, changiert aber auch zwischen nicht-einleuchtend und problematisch.
Von Frederik Eicks
Bild: Hanna Sellheim
Mit eineinhalb Jahren Verspätung kann endlich die nächste Lichtenberg-Poetikvorlesung in Göttingen stattfinden. Träger der vom Literarischen Zentrum Göttingen und dem Seminar für Deutsche Philologie der Göttinger Universität verliehenen Poetikdozentur ist dieses Mal der österreichische Autor Norbert Gstrein. Am 08. Juni, dem ersten von zwei Abenden, wird der Preisträger wie üblich erst nach einer Laudatio auf die ›Bühne‹ gebeten, die dieses Jahr von Stephanie Catani gehalten wird, Professorin für Neuere deutsche Literaturgeschichte in Würzburg. Die ›Bühne‹ ist nun weniger eine Bühne, sondern ein Pult, denn eine weitere Besonderheit ist, dass die Vorlesungen nicht wie sonst in der pompösen Alten Aula der Universität Göttingen stattfinden, sondern im erst kürzlich eröffneten Literaturhaus Göttingen, dessen Interieur man sich kaum gegensätzlicher zur gewöhnlichen Kulisse der Poetikvorlesungen vorstellen könnte.
Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, kam es doch durchaus schon vor, dass die Vortragenden im großen, prunkvollen Saal eher deplatziert wirkten. So steht der Saal des Literaturhauses Norbert Gstrein gut, der besonnen und gelassen seinen ersten Vortrag mit dem Titel Die ohne Not gesagte Wahrheit hält. Laudatorin Catani zufolge nimmt Gstrein mit diesem Titel ein Thema ins Visier, das sich als poetisches Programm durch sein gesamtes Werk zieht. So kommt Catani nach einigen biographischen Daten wie Gstreins Mathematikstudium und seiner Promotion im selben Fach, die tatsächlich auch in seinem eigenen Vortrag eine wichtige Rolle spielen werden, auf sein umfangreiches Werk zu sprechen. Dabei wählt sie den Einstieg über einen Lichtenberg-Aphorismus. Damit sich niemand ob des Klischees schämen muss – Gstrein wird später von der Fremdscham als lichtenberg’scher »Mitscham« sprechen – kommt ein Lichtenberg-Zitat im Kontext der Poetikdozentur natürlich nicht ohne ein selbstreferentielles Augenzwinkern aus. Wie könne man zu diesem Anlass denn nicht Lichtenberg zitieren? Genug aber von Lichtenberg. (Lichtenberg!)
Skeptisches und Anekdotisches
Catanis Laudatio ist überaus gelungen, weil sie um die Funktion ihres Beitrags zu diesem Abend weiß. Eloquent und auf den Punkt stellt sie einige von Gstreins Werken vor, beschreibt seine Poetik als eine »grundlegende Skepsis«, die sich vor allem in seinen »innovativen, mehrstimmigen Erzählverfahren«, die Eindeutigkeiten von vornherein verhinderten, niederschlage. So lehre Gstrein gerade in Zeiten, in denen sich die Menschen nach eindeutigen Antworten sehnten, Widersprüche auszuhalten. Durch Catanis Laudatio bekommen auch die Personen im Publikum, die weniger oder gar nicht mit Gstreins Werken vertraut sind, einen kurzen, hilfreichen Überblick über den Hintergrund, vor dem Gstrein nun seinen eigenen Vortrag halten wird.
Dabei lässt sich Gstrein viel Zeit, bis er tatsächlich auf die Literatur, seine eigene oder diejenige anderer Autor:innen, den Literaturbetrieb und dessen Trends zu sprechen kommt. Er beginnt mit einer etwas zu ausführlichen Schmunzel-Anekdote, die sein persönliches Verhältnis zu Göttingen beleuchtet. Damals als junger Mathematik-Enthusiast sei die Stadt als »Gauß-Pilgerort« – auch hier darf natürlich der Verweis nicht fehlen, dass der Gauß-Bezug in Göttingen sicherlich abgedroschen sei – sein eigentlicher Wunsch-Studienort gewesen. Schließlich habe er in dieser Zeit sogar eine Gauß-Münze um die Brust getragen.
Schillernde Zwitterwesen
Lichtenberg-Poetikvorlesung
Zum 20. Mal findet am 8. und 9. Juni 2022 die Lichtenberg-Poetikvorlesung statt. Sie wird ausgerichtet vom Literarischen Zentrum, gefördert von der Stiftung Niedersachsen und in Kooperation mit dem Wallstein Verlag und der Georg-August-Universität Göttingen organisiert und durchgeführt.
Es geht dann auch erst einmal weiter mit der Mathematik, aus der Gstrein einfach »herausgefallen« sei, und die, wenn nicht die »Sprache Gottes«, so doch wenigstens die »Grammatik der Wirklichkeit« sei. Irgendwann geht es dann um Unendlichkeiten im Plural und den Mathematiker Cantor und plötzlich fällt Gstrein auch in seinem Vortrag aus der Mathematik heraus und hinein in die Literatur. Der Gegenwartsliteratur diagnostiziert Gstrein, Neues nur noch über den Inhalt und nicht mehr über die Form zu generieren. Im Sinne identitätspolitischer Positionen werde der Forderung nach Geschichten aus marginalisierten, zu wenig gehörten Perspektiven stattgegeben. Gstrein erkennt die Bereicherung der Literatur durch solche Geschichten an, beobachtet im Zuge dieses Trends aber zeitgleich ein allgemeines Unbehagen gegenüber Geschichten, »die nur Geschichten sind«. Man wolle sie stattdessen an der Wirklichkeit beglaubigt haben. Trotz momentaner Blütezeit des Romans liegt hier für Gstrein die Gefahr eines Verfalls: Das Publikum wünscht sich den Roman, eigentlich ein »schillerndes Zwitterwesen«, als das, was er nicht ist.
Als Reaktion auf solche Ansprüche kommt Gstrein auf die Autofiktion zu sprechen, die mit ihrem Wahrheitsgehalt insofern spiele, als sie den Lesenden »sowohl ein Authentizitäts- als auch ein Fiktionalitätsangebot« mache. An dieser Stelle geht Gstrein auf seine eigenen Vorstellungen vom literarischen Schreiben ein. Einerseits kritisiert er das Autofiktionale als bloßes Trendwort, wohingegen das Phänomen alles andere als neu sei (womit er auch dem literaturwissenschaftlichen Konsens folgt). Andererseits werde Glaubwürdigkeit ohnehin nicht durch deren bloße Behauptung hergestellt, wie es autofiktionale Texte gern tun, sondern durch »gelungenes Handwerk«. Mit Verweis auf Gottfried Benn, der das viel besser gesagt habe als er selbst, stellt Gstrein den Stil über die Wahrheit.
Bannfluch der Mathematiker
Neben Gauß, Cantor und Lichtenberg bleibt Benn, wie so oft bei solchen Poetikvorlesungen, natürlich nicht die einzige Person, auf die im Laufe des Abends verwiesen wird, sodass sich nach und nach ein europäisch-weltliterarisches, dominant männliches Netz entspinnt, ohne dass es aber hektisch oder überfordernd wird. Der amerikanische Schriftsteller Ben Lerner wird mehrmals erwähnt und der jugoslawische Autor und Übersetzer Danilo Kiš wird für Gstrein bei der Schilderung einer heiklen Lesung in Novi Sad zum wichtigen positiven Bezugspunkt. Der international immens erfolgreiche Norweger Karl Ove Knausgård hingegen muss als Beispiel für eine Literaturform herhalten, der Gstrein wegen ihres übermäßigen Wahrheitsanspruchs nichts abgewinnen könne. Besonders schlimm sei eine Stelle, an der Knausgård beteuert, während des Schreibens weinen zu müssen, was Gstrein wiederum zu Rainald Goetz’ blutigem Auftritt in Klagenfurt und seiner generellen Aversion gegen die sogenannte »Wahrheit der Körperflüssigkeiten« führt – also der Tatsache des Blut- oder Tränenvergießens als Zeugnis der Authentizität.
Interessant ist allerdings, dass Goetz und Knausgård neben Rachel Cusk, die nur in aller Kürze als schlechtes Beispiel genannt wird, die einzigen namentlich erwähnten Negativbeispiele bleiben. Vielleicht liegt das an der zeitlichen beziehungsweise räumlichen Entfernung. Als Gstrein nämlich über die von deutschen Literat:innen ins Internet gesendeten Posts spricht, die bei ihm die lichtenberg’sche Mitscham auslösten, fallen keine Namen. Solche Aussagen dienen ihm dann als Beispiele für ohne Not gesagte Wahrheiten. Es ist zwar unterhaltsam, wie Gstrein den Wunsch äußert, diesen Leuten den »Bannfluch der Mathematiker« (trivial!) entgegen schleudern zu wollen. Warum er aber solche Posts, in denen es seiner Darstellung nach um das Beziehen antifaschistischer (›Breivik-Brief‹) oder antirassistischer (›Obama-Traum‹) Positionen geht, für trivial hält, verrät er uns leider nicht.
Die wohlgesonnene Lesart lautet: Antifaschismus sollte selbstverständlich und deswegen trivial sein. Vor dem Hintergrund seiner Auslassungen zur (identitäts-)politisch motivierten Literatur lautet eine andere, ebenso naheliegende Lesart, dass Gstrein nichts von politischer Kunst hält und damit seine eigenen Texte über die Texte derjenigen stellt, die er hier mittels einer auch recht unhöflichen Nonmention kritisiert. Egal, wie weit man ihm entgegenkommen möchte: Hier offenbart Gstrein einen blinden Fleck, der angesichts der sonstigen Akribie des Logikers, mit der er vorgeht, überrascht. Dieser Fleck nimmt die Form politischer Realitäten an: Wenn Gstrein am 09. Juni seinen zweiten Vortrag hält, ist İsmail Yaşar seit genau 17 Jahren tot – ermordet aus rassistischen Motiven vom NSU, dessen Mord- und Anschlagsserie zehn Jahre nach der Selbstenttarnung immer noch nicht vollständig aufgeklärt ist.
Auslaufen in langen Oder-Sequenzen
Sein blinder Fleck erklärt dann auch, warum Gstrein behauptet, dass es solchen Leuten und generell allen Personen der »lautsprechenden Medien« guttäte, mindestens vier Semester Mathematik und Logik zu studieren. Logisch betrachtet ist es natürlich überflüssig, im besten Sinn Triviales wie ›Keinen Fußbreit den Faschisten‹ ständig zu wiederholen. Dadurch unterstellt aber der Logiker, der nicht zu verstehen scheint, wie unlogisch Menschen denken und handeln, den Personen Unwissenheit statt Absicht. Dabei ist nur schwer zu glauben, dass beispielsweise die BILD-Redakteur:innen den ganzen Stuss, den sie verbreiten, tatsächlich glauben. Explizit Ökonomisches oder Politisches als Motiv kommen bei Gstrein aber nicht vor. Sonst könnte er ja auch nicht behaupten, die formale Bildung allein, die ihm vorschwebt, löse irgendwelche Probleme. Über die Forderung nach Mathe-Pflichtsemestern schlägt Gstrein schließlich wieder den Bogen zurück zur Mathematik und vor allem zu seiner eigenen, von der Mathematik geprägten Biographie und wie diese Prägung schließlich von Beginn an auch sein literarisches Schreiben beeinflusst hat: »Ich wollte am liebsten jeden Satz in langen Oder-Sequenzen auslaufen lassen, um der Wirklichkeit gerecht zu werden.«
In der Aussagenlogik ist eine disjunktive, das heißt eine Oder-Aussage genau dann wahr, wenn mindestens einer der auf diese Weise verknüpften Sätze stimmt: (A) Beim Schreiben seines ersten Romans habe er sich gefragt, was wohl sein Mathematik-Freundeskreis von ihm denken würde, wenn der wüsste, dass er sich in seiner Freizeit der ungenauen Kunst der Literatur widmet – oder (B) irgendwann habe er dann erfahren, dass der namentlich von ihm nicht genannte, aber weltweit renommierte kalifornische Logiker, bei dem er zu dieser Zeit Vorlesungen besucht hat, in seinen letzten Lebensjahren Gedichte geschrieben habe – oder (C) das sei für Gstrein das stärkste Argument für die Literatur – oder (D) Gstrein selbst lässt seinen Vortrag gar nicht in langen Oder-Sequenzen auslaufen. Nun sind alle diese Sätze wahr. Das kann man trivial finden. Wenigstens bei (C) sollte man aber stutzen: Die Behauptung der Tatsache des dichtenden Logikers als stärkstes Argument für die Literatur ist ja gar kein Argument, sondern nur die Behauptung eines Arguments. Und dann geht es eben doch um den Inhalt.
Frederik Eicks war von April 2020 bis Oktober 2021 Volontär im Literarischen Zentrum und studiert am Seminar für Deutsche Philologie.