Es ist gerade einmal ihr drittes Buch und das hat es bereits auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreises geschafft: Gemeint ist Maren Kames‘ Roman Hasenprosa. Darin unternehmen der titelgebende Hase und die Erzählerin mit ihrer Leser:innenschaft eine entgrenzte Reise quer durch Zeit und Raum.
Von Marie Bruschek
Mit einem langohrigen Tobetier als Begleiter schnappt sich die Ich-Erzählerin ihre Meilenstiefel und Reisesocken und macht sich auf und davon: durch verschiedene Zeiten, Orte, Gemütszustände, Träume, Erinnerungen. So ließe sich Maren Kames’ Hasenprosa zusammenfassen. Gerade einmal rund 170 Seiten umfasst der Roman, doch diese sind gut gefüllt mit Wortwitz, Sprachgewandtheit und Charme – sodass der autofiktionale Text seine Leser:innenschaft mit Leichtigkeit für sich einnehmen kann.
Die Biographie Kames’ ist Grundlage des Romans: ein Großteil ist gefüllt mit dem Reminiszieren über ihre Geschwister, die Mutter, ihre Großeltern und sie selbst, bebildert mit passenden Fotos. Es sind alte Fotos von Kames auf dem Schoß ihres Opas (mit einer Schachtel Zigaretten in der Kleinkindhand), Screenshots von Buntspechts Musikvideo zu Unter den Masken, das Sternbild des Hasen, Skizzen sowie eine Bilderstrecke zu den sogenannten Hasenohrkakteen zu entdecken. Der Text beinhaltet, wie an den Bildern schon deutlich wird, etliche intertextuelle und intermediale Bezüge. So gibt es Referenzen zu Autor:innen, Sänger:innen und Songs: Die Schriftstellerin kreiert ein dichtes Netz, in dem sich Hase, Leser:in und die Erzählerin fallen lassen können. Das macht die Lektüre nicht nur vielschichtig, sondern zeigt auf, in welchem Kunstkanon Kames sich verortet: Zwischen Pop-Ikonen wie Prince und Künstler:innen wie Agnes Grey, zwischen Jean-Michel Basquiat und Friederike Mayröcker. Das Erwähnen dieser Namen ist ein Hinweis darauf, welche Inspirationsquellen zu Hasenprosa beigetragen haben. In der Rezeption verstärkt sich der Eindruck: Das Genre Hasenprosa ist wortgewaltig, sprunghaft und selbstreflexiv.
»Bahnbrechende Bescheuertheit«
Die Erzählerin macht sich mit Beginn des Romans auf einen Weg ohne klares Ziel, begleitet von dem an Alice im Wunderland erinnernden Hasen (dem »Meister von allem«). Sie reist auf den Grund ihres Herzens (ein provinzielles und durchschnittlich großes Exemplar), zurück in die Erinnerung an ihre Großeltern, in die eigene Wohnung, ins Elternhaus in »Waldhessen«, ins Weltall (voller »Versenkungsidole«), in die Savanne. Dabei reflektiert die Erzählerin manchmal für sich, manchmal im Gespräch mit dem Hasen, über sich selbst und ihre Biographie, ihre Verwandten, ihre Inspirationen, aber auch über Politik, Arten von Kakteen, Liebe, der Etymologie des Wortes Hexe, Löwenmäulern, Urmündern und Neumündern und über das Älterwerden. Der Roman beschreibt die »Zeiten des Fliegens und die Zeiten des Stürzens, Zeiten des Wachsens und Zeiten des Schrumpfens, die Zeiten der Aufruhr und die Zeiten der Ruhe«.
Maren Kames’ geschickter Sprachgebrauch fällt auf: Ihre Sätze sind voller Wortgewalt und Wortgewandtheit. Heißt es zu Beginn des Buches noch: »Wie arglos ich war, wie zartblau«, werden später die Sterne mit einer »Million emaillierter Insekten« verglichen, deren Namen teils klingen, als würde man rückwärts reden. Da sagt der Hase ganz verträumt »Denk mal: Esah, Neram – wir könnten auch Sterne sein«. Als Opa Erich mit ihr und ihren Geschwistern erwärmte Knete gegen die Wand wirft, ist das nicht eine spaßige Erinnerung, sondern war für die Drei »von so tollkühner, glorreicher, bahnbrechender Bescheuertheit, die in diesem Moment aus diesem sonst verhältnismäßig feinen, älteren Herrn herauskam«. Die Sprache nimmt eine große Rolle ein, ihr einzigartiger Gebrauch ist ein Kernmerkmal des Romans. Ihr Spiel mit der Sprache ist eine Freude zu lesen. An manchen Stellen hat es auch eine traurige und tiefsinnige Wirkung, an anderen wiederum ist es lustig und leicht, wenn beispielsweise die Rede vom weltberühmten »Singengel Peter Gabriel« ist.
Lyrische Traumprosa und Autofiktion
»Dass das Jahr des Hasen, dachte ich, bereits vorüber sein würde, wenn das Buch auch außen zu existieren beginnt.«
Der Schaffensprozess von Hasenprosa wird immer wieder thematisiert. Auch warum sich Kames in ihrem dritten Buch mit einem Hasen, Familie, Prince und Friederike Mayröcker befasst, wird aktiv reflektiert, was eine metapoetische Ebene eröffnet. Die Gründe für die Beschäftigung mit ihr sehr zugänglichen Themen liegen unter anderem in einer gewissen Erschöpfung durch das zweite Buch, durch das Kames viel mit endlosen Events und dem Kulturbetrieb zu tun hatte. Das formuliert sie so: »Also in den Abhängigkeiten (Heckenrosen) stand ich, am deutlich kürzeren Hebel, von allen mindestverantwortlichen Geistern verlassen, höchst selbstständig inmitten der schönsten Metaphysik meiner Branche (ein Blumenbeet) und sah zu, wie das Gift sickerte«. Die Reaktion darauf ist die Flucht auf das Land, wo die Erzählerin immer wieder hin zurückkehrt, in die Heimat. Der Hase ist ein Resultat dieser Krise: »So nahm ich mir einen Hasen«, so »dachte ich mir einen Hasen«. Die Reise folgt keinen realistischen Begründungen, die beiden Figuren laufen, schlafen, fliegen und schwimmen im ästhetischen Raum. Die Gesetze der Physik fallen weg, mit der Sprache agieren beide spielerisch, ganz im Reich der Phantasie verloren.
Die skurril-fantastische, teils märchenhafte Reise der beiden, das Fallen und Fliegen, wird innerhalb des Textes auf der Metaebene besprochen. Auf Seite 118 sagt der Hase: »ich glaube wohl, der Bann ist gebrochen, wir sind auf Seite 118, haben die Hundertergrenze überschritten, wir fliegen weiter.« Auch wie das Buch enden könnte, überlegen beide aktiv zusammen und nehmen die Leser:innen dabei mit. Wenn erzählt wird, dass der Hase davon stakst, sagt dieser daraufhin: »Hasen staksen aber nicht!«. Dieses Spiel mit der Erzählung und ihren Ebenen ist ebenfalls eine Charakteristik der Hasenprosa. Dass es keine Anführungszeichen innerhalb des Textes gibt, lässt die Kommunikationsebenen sowohl in der Rezeption als auch zwischen Hase und Erzählerin verwischen. Hase und Protagonistin treffen sich auf dem Blatt Papier und kommunizieren verbal, nonverbal, telepathisch. Der Hase reagiert auf unausgesprochene Gedanken der Ich-Erzählerin, durch das Fehlen der Anführungszeichen überschreitet der Dialog so die Grenzen des Gesprochenen. Was Kames nur als Gedanken festhält oder ihre Figur in den Mund legt, ist nicht klar.
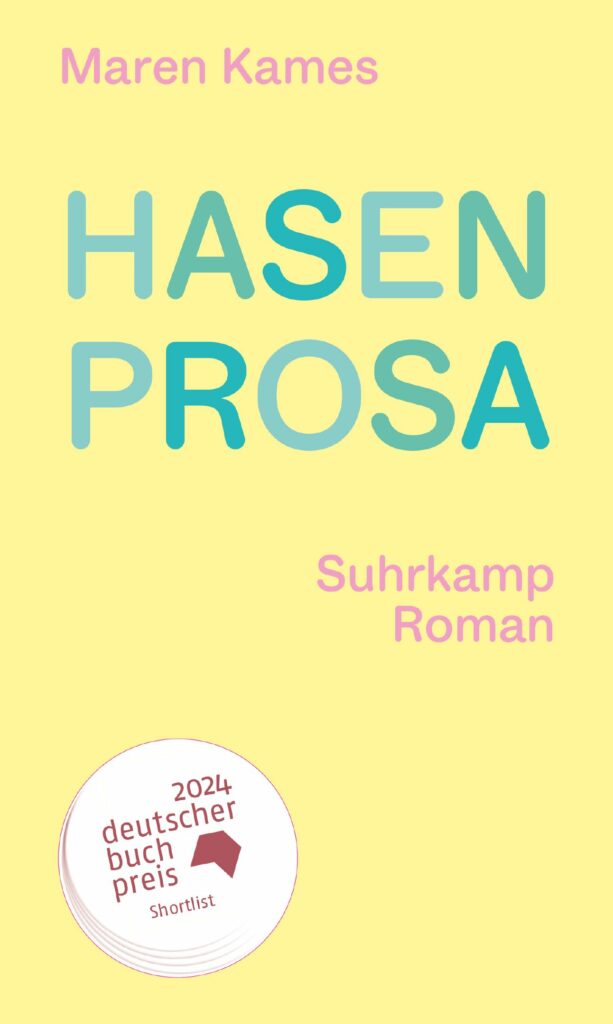
Hasenprosa
Suhrkamp: 2024
182 Seiten, 25 €
Kames schreibt auch über ihre Bedenken bezüglich der Realitätsbezüge von Autofiktion: »So – wie viel erzählst du, von den Leuten in deiner Familie?« und »Führst du deinen Opa, Bruder vor, und wenn du’s noch so gut meinst, mit noch so vollem Herzen? Ja.« Doch Menschen und Momente geraten einfach in den Text hinein, werden dadurch »fest, dingfest«. Der Text selbst interpretiert sich trotz dieser Metaebene keineswegs selbst: »es ist nur eine kleine Geschichte, den Rest kann man sich selber denken«, sagt die Protagonistin an anderer Stelle, fasst es damit gut zusammen.
Ein Manifest gegen Realismus
Die Gespräche zwischen Hase und Erzählerin sind unterhaltsam, philosophisch, anregend, mal lang und ausgeschmückt, mal knapp und auf den Punkt gebracht: »Bist du alt? / Ein bisschen. / Sind die krassen Zeiten vorbei? / Ich glaube ja. / Tut das weh? / Ein wenig.« Der Hase, dieser von der Protagonistin selbst ausgedachte Helfer, beschreibt sich selbst so: »Ich bin niedlich und windig, deshalb verzeihst du mir!«. Dass er an ein Kuscheltier angelehnt ist, welches die Erzählerin bei ihren Eltern wiederfindet, wird ebenso angedeutet: »ich drapiere den Hasen in meinem Bett, seine schlotterlangen Arme, Beine und ellenlangen Ohren jeden Morgen je nach Stimmung, bevor ich mich an den Text setze«.
Hasenprosa ist eine Geschichte über eine Autorin, die nach ihrem zweiten Buch verzweifelt, bei ihren Eltern Rückzug sucht, wieder den Zugang zum Schreiben finden muss. Doch vielmehr ist der Roman ein Manifest gegen Realismus, ein Aufruf zum Reminiszieren, zum Spiel mit Sprache, zum »Punk, Punk, Punk«. Das funktioniert: »ich schreibe wohl wieder, immerhin schreibe ich wieder, und das Schlimmste ist wohl überstanden«.






