Wer prägt so sehr wie die eigene Mutter? In Sylvie Schenks Roman Maman, platziert auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2023, sucht eine Tochter in Akten und Imaginationen nach ihren Vorfahrinnen – und dabei auch nach sich selbst.
Von Diana Muth
Bild: József Rippl-Rónai: Mother and Daughter in Summer House, via Wikimedia Commons, public domain (Ausschnitt)
Herkunft sitzt in den Knochen. Auch dann, wenn man über sie nicht viel weiß. Auch dann, wenn man in den 40er-Jahren in eine standesbewusste, gutbürgerliche Familie einheiratet, wenn man Pelzmantel trägt und das Dienstmädchen verbal herabwürdigt – wie die Mutter der Protagonistin.
Sie war eine Mutter, die schwieg, »ein Verstand, der damit beschäftigt war, seine Mängel zu kaschieren«. Überhaupt seien unsere Mütter die erste wichtige Frage, die Quelle all unserer Neurosen. So formulierte es Sylvie Schenk augenzwinkernd in einem Gespräch mit Dorothee Röhrig und Elisabeth Ruge im Literaturhaus Berlin über ihren leichtfüßig geschriebenen, autofiktionalen Roman Maman, der wegen seiner Platzierung auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2023 auf sich aufmerksam machte.
Exploration anstatt Explosion
Wo aber im Klappentext von »explosiver Literatur« die Rede ist, da hätte das Attribut ›explorativ‹ stehen müssen: inhaltlich und formal. Denn einerseits erkundet die Protagonistin im Roman ihre weibliche familiäre Linie in Archivakten und andererseits wagt Schenk sich über erzählerische Konventionen hinaus.
Ein Text über Herkunft ist das Ansinnen der Ich-Erzählerin. In Archiven erfährt sie, dass ihre Großmutter eine Seidenarbeiterin und Prostituierte war, doch da die Akten nur spärlich Auskunft geben, folgen Fragen auf Fragen. Die vielen verbliebenen Leerstellen füllt die Protagonistin, indem sie sich szenisch Schlüsselerlebnisse in den Biografien ihrer Ahninnen vorstellt und ausmalt. Ebendiese Momentaufnahmen, schlicht und poetisch geschrieben, machen die Stärke der Autorin aus. Man wähnt sich dann Seite an Seite mit den Wäscherinnen an der Rhône, Kernseife und Kälte hängen in der Luft.
Manchmal allerdings schlägt dieses Moment der Nähe, der Unmittelbarkeit der Erzählung in Seichtigkeit um. Die Figuren und ihre Situationen sind dann uneingeschränkt hell oder dunkel – oft sieht man sich einem schnellen Wechselspiel von Hoch- oder Tiefgefühlen gegenüber. Da wird gesäuselt, gestreichelt, mit schwelgendem, »magisch und reichlich erfülltem« Mutterglück »meine kleine Prinzessin« gemurmelt oder eben geschrien, geohrfeigt und gehasst. Sicherlich ruft das im Lesenden bisweilen einen wirkungsvollen emotionalen Effekt hervor. Gegen den Vorwurf, der Roman sei passagenweise kitschig, vermag man ihn aber nicht zu verteidigen.
Dennoch bleibt man am Ball, wenn man dem, was inhaltlich verhandelt wird, etwas abgewinnen kann: Es sind die Wurzeln der notorischen Unsicherheit sozial Aufgestiegener, die von der Erzählerin erkundet werden – das Gefühl, zwischen Herkunfts- und Aufstiegsmilieu einfach keinen Platz zu finden. Hinzu gesellt sich gesellschaftlich tief verankerte Misogynie, deren Macht und Fortwirken im Roman sprachlich brüsk offengelegt werden. So verschränken sich in der Identität der Protagonistin die Herkunft und die gesellschaftlichen Verhältnisse komplex. Mit dann wieder amüsanter Unmittelbarkeit erwägt sie: »Vielleicht sitzt meine Mutter an der Quelle meiner von Neid und Faszination gemischten Furcht vor Intellektuellen, vor Menschen, die mit abstrakten Begriffen jonglieren, vor überheblichen Besserwissern aus gebildeten Familien, auch vor starken und MeToo-Frauen, die Bescheid wissen, gescheit reden und recht haben«.
Erkundung erzählerischer Formen
Doch es kommt noch ein weiteres exploratives Moment ins Spiel, denn Schenk wagt sich, wie auch in ihrem 2016 erschienenen Roman Schnell, dein Leben (Hanser Verlag) über erzählerische Konventionen hinaus. In den Rückblenden, in denen die Geschichten der Vorfahrinnen erzählt werden, wird szenisch mehrfach die Illusion einer allwissenden Erzählerin erschaffen – um gleich darauf wieder eingerissen zu werden. Die Protagonistin macht dann die Fiktion offenkundig und sich darüber hinaus selbst zu einer handelnden Figur in der jedoch realistisch präsentierten Imagination der großmütterlichen Vergangenheit. Die Erzählerin begleitet beispielsweise ihre grand-mère als Freundin in die Schule einer französischen Provinz, legt sich zu ihr ins Sterbebett, um ihr die Zukunft der Familiengeschichte zuzuflüstern. Bemerkenswert ist, wie dadurch greifbar wird, auf welche Art wir uns biographische Narrative konstruieren, im wörtlichen Sinne: Geschichten über uns selbst erzählen. Darin schwingt auch eine Kontingenzperspektive der Vergangenheit mit, des Erinnerns und Imaginierens überhaupt: Es könnte so gewesen sein, aber ebenso ganz anders – und unabhängig davon, wie es ›tatsächlich‹ war: So möchte es sich die Erzählerin vorstellen. Allen unbeantwortbaren Fragen zum Trotz.
Ein Auf und Ab – nicht nur für die Figuren
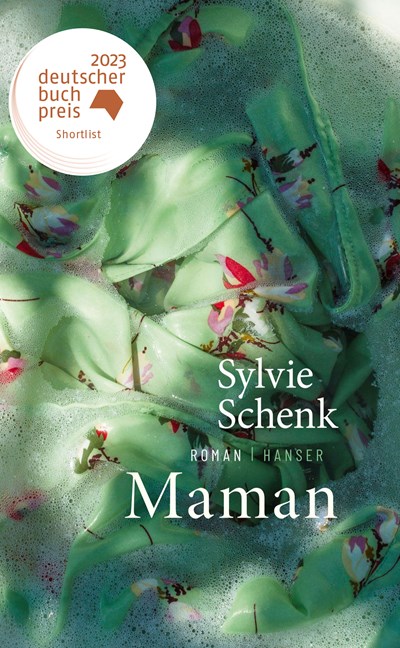
Maman
Hanser Verlag: München 2023
176 Seiten, 22,00 €
Der Roman ist durch die erzählerische Nähe zum Geschehen, durch die formal innovativen Elemente und die unprätentiöse, leichte, poetische Sprache bisweilen berührend, ihm wohnt etwas Versöhnliches inne. Gleichwohl ist die Lektüre ein Auf und Ab. Da ist zum einen das störende, schon thematisierte Element des Seichten. Ferner bleibt man von Zeit zu Zeit ratlos an schiefen Metaphern hängen. Wenn es zum Beispiel heißt: »meine Mutter blieb den Wechselfällen des Lebens ergeben wie ein Fläschchen im Ozean. Ihr Innenleben aber war voll von Algen und Tieren«, vermag man sich keinen rechten Reim darauf zu machen, was das nun eigentlich bedeutet.
Zudem ist das Buch nicht nur durch die groß gedruckten 176 Seiten kurzatmig – diese Wahrnehmung wird vor allem dadurch begünstigt, dass alle zwei bis drei Seiten ein neues Kapitel beginnt. So entsteht, vor allem zum Ende hin, der Eindruck, dass der Text zerfasert, sich verliert. Ebendas geschieht, trotz der Kürze des Romans, sukzessive mit der Aufmerksamkeit der Lesenden. Vielleicht hätte es mehr Umfang gebraucht – für einen roteren Faden und mehr Raum für Schattierungen.






