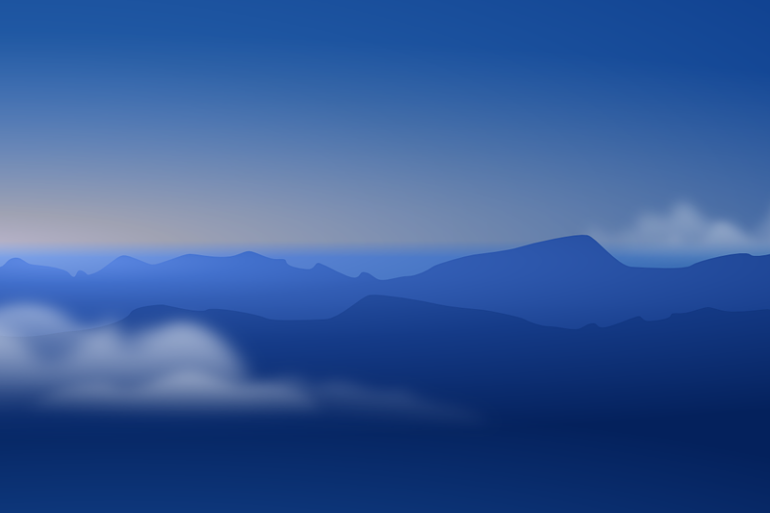In Tasmanien (aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Kleiner) schildert Paolo Giordano die Auseinandersetzung eines Journalisten und Schriftstellers mit der Gegenwart. Die autofiktionale Figur namens Paolo flüchtet vor dem Ende ihrer Ehe und der eigenen Kinderlosigkeit, indem sie sich mit Terrorismus und dem Klimawandel beschäftigt. Dabei gelingt es Paolo jedoch nicht den eigenen Standpunkt als weißer, gut situierter Mann kritisch zu reflektieren. Stattdessen versinkt er stellenweise in Selbstmitleid.
Von Lisa Neumann
Alles beginnt mit der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015, zu der Paolo reist, um für eine große italienische Zeitung zu berichten. Schnell wird klar, dass er eigentlich vor einer Beziehungskrise und seiner Partnerin flieht, nachdem diese ihm mitgeteilt hat, dass sie nicht weiter versuchen möchte, ein gemeinsames Kind zu bekommen. In Paris lässt sich der Autor treiben, bald beginnt er ein neues Buchprojekt über die Atombombe, das jedoch nur müßig vorangeht.
Verdrängung und Flucht in Katastrophen
Statt sich seiner Lebenskrise zu stellen, weicht er immer mehr in die eigene Arbeit, die journalistische und private Beschäftigung mit den großen Katastrophen unserer Zeit aus: dem Klimawandel, dem Terrorismus, der Atombombe. Doch Paolo kann seinem eigenen Leben nicht entkommen, auch wenn er versucht sich dies einzureden. Offensichtlich wird das besonders, als der Wolken- und Klimaforscher Novelli, den er für seine Zeitung interviewt und mit dem er sich privat anfreundet, an den öffentlichen Pranger gestellt wird. Novelli hat eine Professur in seiner Heimat nicht erhalten, mit der er fest gerechnet hatte. Dass diese an eine medial unbekanntere Forscherin ging, trifft Novelli schwer. Auf einer öffentlichen Konferenz zum Thema weibliches Engagement gegen den Klimawandel stellt er seine neueste Studie vor, eine Erhebung, nach der Frauen in akademischen Positionen weniger erfolgreich sein sollen als Männer und belegt dies unter anderem mit dem Impact-Faktor, also der Zitierhäufigkeiten von Publikationen – ein fragwürdiges Mittel. Prompt kommt der Shitstorm und Novelli wird auf Twitter angegangen. Auch Paolos Bekannte Marina bezieht Stellung:
»Der Algorithmus zeigte mir einen Thread von Marina an, argumentativ und traurig, in dem sie direkt auf ihn antwortete, von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftler, von Physikerin zu Physiker, sie ging auf seine Analyse ein, indem sie sowohl deren Voraussetzungen als auch die Interpretation kritisierte. Wenn er aufwies, wie die Leistungskurven von Männern und Frauen nach der Dissertation auseinanderstrebten (vorausgesetzt, das stimmte), hatte Novelli die Schlüsselbegriffe jeder sinnvollen Untersuchung zur Geschlechtergleichheit unberücksichtigt gelassen: den in der akademischen Welt tief verwurzelten Chauvinismus, die Care-Arbeit, die sozialen Rahmenbedingungen.«
Paolos ganzes Umfeld bezieht Stellung zu dem Konflikt, doch er selbst schweigt. Die große Katastrophe hat ihn im Kleinen eingeholt, das Problem wächst ihm als Mann über den Kopf, er fühlt sich auch wegen seiner Privilegien schuldig. Einer der wenigen Momente im Roman, in denen Paolo die eigene Perspektive reflektiert, den Spiegel vorgehalten bekommt. Eine Lösung für das Problem ist wie bei allen Thematiken, mit denen sich der Protagonist beschäftigt, nicht in Sicht. Zu komplex sind die politischen Irrungen und Wirrungen unserer Zeit.
Zu viel Pathos
Der Roman beschreibt oftmals treffend die Fragen und Herausforderungen unserer Gegenwart. Darf man für eine Woche wie Paolo und seine Frau in ein Hotel in die Karibik fliegen, obwohl man sich eigentlich für klimabewusst hält? Wie beeinflusst der Terrorismus Europa und menschliche Werte?
Leider rutscht der Erzähler in teils übertriebenes Pathos ab, wenn es um sein eigenes Leben geht. So reflektiert er in Bezug auf einen Freund, der katholischer Priester ist und sich in eine Studentin verliebt hat:
»Er hatte sich zwanzig Jahre lang aufgespart, und jetzt konnte er diese angestaute Euphorie genießen, wie der junge Mann, der er nicht gewesen war. Die Vorfreude auf die gemeinsame Nacht, der Schauer der Überschreitungen: alles Dinge, die mir nunmehr für immer verwehrt schienen.«
Paolo versinkt immer mehr im Selbstmitleid. Schade, denn Selbstironie und die Reflexion der eigenen Position als älterer, weißer, akademischer Mann hätten der Erzählweise gut getan.
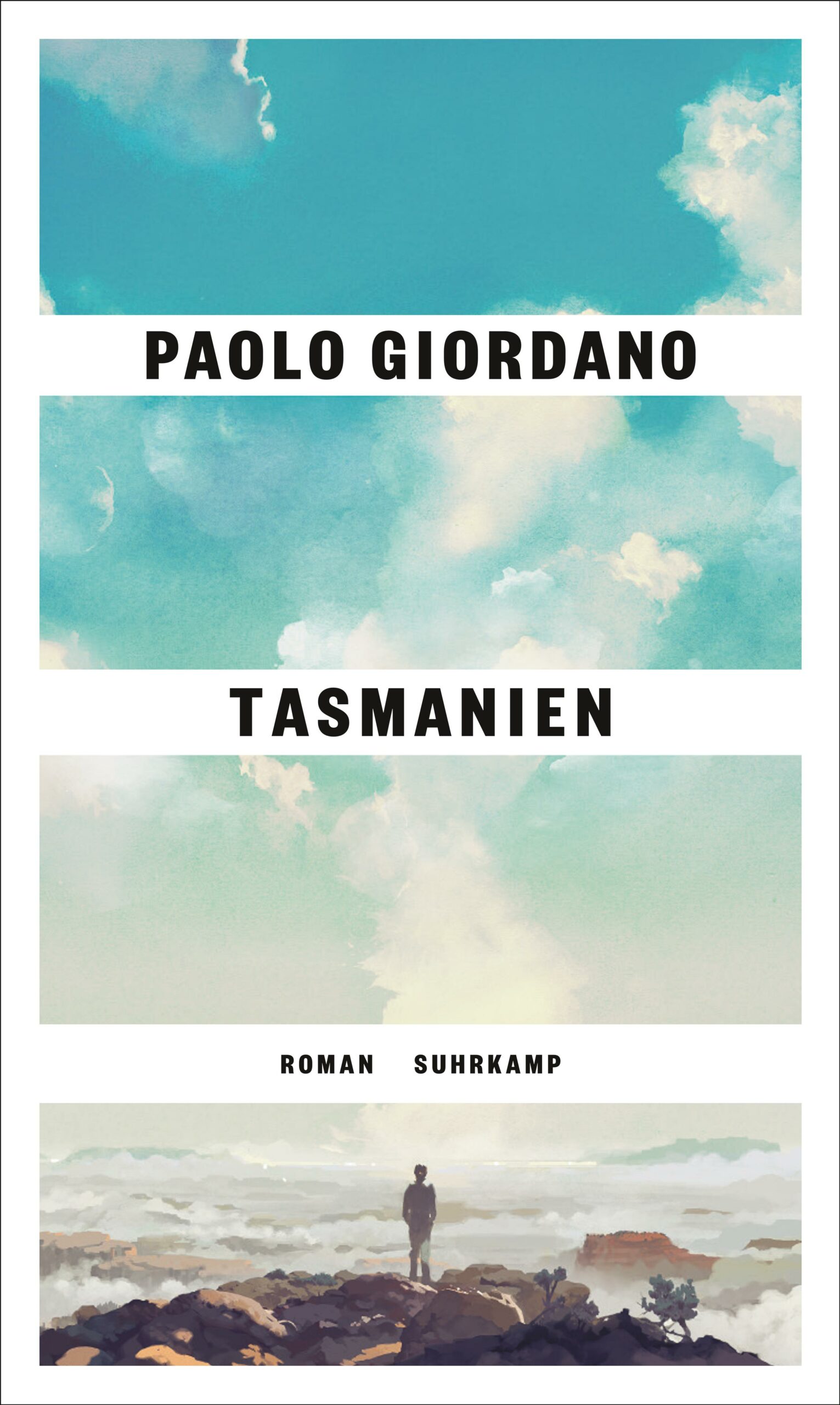
Paolo Giordano
Tasmanien.
Roman
Aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Kleiner
Suhrkamp Verlag: Berlin 2023
335 Seiten, 25 €
Stellenweise gelingen Giordano dennoch starke Beschreibungen. Besonders berührend ist dabei die Geschichte von Terumi Tanaka, der als Junge den Abwurf der Atombombe auf Nagasaki überlebte. Paolo spricht mit ihm via Zoom für sein Buchprojekt und sieht ihn später bei der Gedenkfeier in Nagasaki für seine Recherche wieder. Sensibel erzählt Paolo auf wenigen Seiten Tanakas Geschichte: die Unschuld und Naivität des Jungen, der sieht, wie die ganze Stadt um ihn herum stirbt, sticht dabei besonders hervor.
Keine einfachen Lösungen für politische Probleme
Giordanos Roman, der übrigens Tasmanien (Originaltitel: Tasmania) heißt, weil man dort laut Novelli eine Klimakatastrophe in der Zukunft vielleicht überstehen könnte, offenbart, dass es für die großen Probleme unserer Zeit keine einfachen politischen Lösungen gibt. Wie sehr jene politischen Probleme das Individuum beeinflussen, zeigt sich anhand des Erzählers, dessen Obsession mit bestimmten Themen einen Ersatz für ein fehlendes Kind als Lebensinhalt darstellt. Leider berührt Paolos persönliches Schicksal beim Lesen nicht sonderlich. Er lebt im Einklang mit seiner akademisierten, männlichen Sichtweise, ohne diese Blase viel oder gar selbstironisch zu reflektieren.