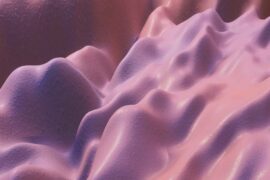Ernst-Wilhelm Händlers Roman München kommt nicht mit überbordender Handlung daher. Stattdessen nimmt Händler mit klinischer Genauigkeit und sprachlich ausgefeilt das Leben der Münchner Schickeria aufs Korn. Das kann manchmal etwas trist werden.
Von Florian Pahlke
Bild: Baile del Santiago antiguo via Wikimedia / CCO
Auf die Handlung reduzieren darf man den Roman München von Ernst-Wilhelm Händler nicht. In Form eines Gesellschaftsromans wird dem Leser die überbordende und dennoch oder gerade deshalb reichlich triste Welt der Münchner Schickeria präsentiert: Thaddea, eine wohlhabende Therapeutin, besitzt zwei Häuser in bester Lage, hat sich mit ihrer Praxis gerade selbstständig gemacht und auch sonst hat sie alles unter Kontrolle. Bis – wie sollte es anders sein – ihr Freund Ben-Luca sie mit ihrer besten Freundin Kata betrügt und sie somit auf einen Schlag die zwei engsten Vertrauten in ihrem Leben verliert. Dass sie daraufhin mit Ben-Lucas bestem Freund anbändelt, qualifiziert die Storyline für kaum mehr als den Sat1-Film-Film. Händlers Roman hebt sich von solchen Schmachtfetzen jedoch ab, indem er die Geschichte und ihre Dramatik nicht in den Vordergrund stellt und ausschlachtet. Stattdessen erhält der Leser einen sezierend genauen Blick; analytisch kalt, oft fast erbarmungslos kann man die ProtagonistInnen und ihre Umwelt beobachten. Selbst die Gedanken Thaddeas, aus deren Sicht der Roman geschrieben ist, wirken oft eher wie architektonische Beschreibungen. Der Lesespaß wird hier zur Freude an Details, in ihrer Häufung immer die Grenze zur Obsession berührend, manchmal überschreitend.
Es gibt eine Passage, die für Thaddea genauso exemplarisch steht wie deren sprachliche und syntagmatische Aufbereitung für den Roman. Der erste Patient in ihrer neuen Praxis verlässt diese schlagartig wieder, nachdem Thaddea in ihrem Entsetzen, dass er ein schrecklich verunstaltetes Gesicht hat – ihm fehlen Teile der Wange in Folge eines Blitzschlages –, gar nicht dazu kommt, ihn als Patienten ernst zu nehmen.
Bevor sie sich hinsetzte, rückte sie ihren Sessel so zurecht, dass sie den Mann nicht von der linken Seite betrachten musste. Für eine unverbindliche Konversation war es viel zu spät. Allein der Versuch hätte die Peinlichkeit ins Unerträgliche gesteigert. Sie wollte ohne Vorrede beginnen, da merkte sie, dass sie weder die Unterlagen zur Hand noch die Utensilien parat hatte, mit denen sie sich Notizen machen konnte. Ohne Erklärung erhob sie sich.
Thaddea, auf ihren eigenen körperlichen Makel zurückgeworfen, den sie im Kindesalter erlitt, als ein Lastwagen ihr über die Zehen fuhr, analysiert die Situation und sich selbst ausführlicher als ihren Patienten, bleibt aber selbst in diesen Betrachtungen unpersönlich. In diesem Zusammentreffen kulminieren all die Ängste und Spleens, die Thaddea zu kaschieren sucht. Das Humpeln in Folge ihrer Verletzung unterdrückt sie im Alltag, über das ihr Wichtige, ihre Ängste und Emotionen, redet sie nicht, ihren entstellten Patienten behandelt sie nicht angemessen, weil sie es nicht schafft, über die Offensichtlichkeit der Verstümmelung zum eigentlichen Problem des Patienten vorzudringen.

Ernst-Wilhelm Händler
München
S. FISCHER Verlag 2016
352 Seiten, 23,00€
Thaddea bleibt an der Oberfläche und zerschellt dabei gewissermaßen an sich selbst, da sie auch für ihre eigenen Probleme kein anderes Instrumentarium kennt als für ihre Patienten, die sie kaum ernst nimmt. Das dem Roman vorangestellte Zitat aus Musils Mann ohne Eigenschaften »Man kann nicht nicht wissen wollen« gibt gleichermaßen zynisch wie treffend die Richtung und Begrenzung einer Gesellschaft vor, in der selbst die vermeintlichen Interessen der Personen affektiert wirken. Händler lässt die Subjekte in seinen Beschreibungen mit den Objekten verschmelzen – Personen werden gleichermaßen zum Beobachtungsgegenstand wie Lippenstifte oder Fensterfronten –, was zu einer merkwürdigen Schieflage zwischen Emotionen und Handlungen führt. Der gesamte Roman wird dabei zu einer Ansammlung von assoziativ-verbundenen Analysen, die nur schleppend durch die Handlung tragen. Höhepunkte finden sich dabei nicht auf der Ebene der Handlung, sondern im Kleinen, in der Freude am pointierten Sarkasmus, in dem die Familie dann schnell als »Kollateralschaden des Lebens« abgetan wird. Dieser Sarkasmus wird von Händler bis ins Skurrile weitergetrieben, das zeigt sich schon daran, dass Thaddea als Therapeutin keinerlei Interesse für Gründe und Ursachen hat und auch Ziele für überflüssig hält, sich dafür aber seitenlang Gedanken über die architektonischen Besonderheiten ihres Hauses, der, wie sie es nennt, »Struktur«, macht. Erst ein einschneidendes Erlebnis wie der Bruch mit all ihren Beziehungen führt dazu, dass Thaddea sich daran macht, ihr eigenes Ich zu erkunden. Die Erkundung fällt dann allerdings ähnlich bemüht aus wie ihr bisheriges Leben: Ihr Entschluss, einen Roman zu schreiben, in dem es um ihre Familie geht, in dem sie aber weder beobachten noch beschreiben, sondern nur Metaphern benutzen möchte, zerplatzt schon nach kurzer Zeit wieder.
Nicht ansatzweise so verkrampft wie seine ProtagonistInnen auf diversen Eröffnungen und Empfängen nimmt Händler die LeserInnen in die Themenfelder Mode, Architektur und Kunst(wissenschaften) mit. Es sind diese Beobachtungen, die den Roman zusammenhalten und die Figuren beschreiben. Die Figurenportraits sind immer auch Betrachtungen ihrer Gesten, ihrer Kleidung und ihres Habitus – und in diesem Sinne muss man den Roman auch als Beschreibung einer Gesellschaft verstehen. Einer Gesellschaft schließlich, die leider nicht mehr offenbart als ihren Snobismus, den Händler mit einer gewissen Freude und Kenntnis auseinandernimmt. Auch die Tatsache, dass er sich keine Mühe gibt, die beschriebenen Personen der Münchner Society hinter falschen Namen zu verstecken, offenbart, wie sehr Händler sich in den Kreisen auskennt, die er hier verkopft-stilvoll aufs Korn nimmt. Die Handlung des Romans allerdings, und hier kommt dann doch zum Tragen, dass diese nicht über eine durchschnittliche Fernseh-Produktion hinausreicht, trägt nicht wirklich über 350 Seiten. Dass Thaddea sich am Ende ein – wenn auch einfaches, fast schon banales – Ziel setzt, ist kaum Trost dafür, sich bis ans Romanende vorgekämpft zu haben. Händlers Schreibstil ist ausgefeilt und analytisch präzise, aber in seiner Repetition nutzt er sich ab. Zurück bleibt ein Textkonvolut, von dem man sich wünscht, es wäre als Novelle konzipiert.