Takis Würger sieht sich starker Kritik ausgesetzt. Dabei geraten seine Person, sein Roman Stella sowie Erzählinstanz und Figuren durcheinander. Selbst berechtigte Klärungsversuche können schwerwiegende Zweifel am Autor und seinem Schreiben nicht zerstreuen.
Von Nikolai Wittenstein
Bild: by geralt via Pixabay, Pixabay Lizenz
Takis Würger wird der Prozess gemacht. Es stimmt, was Stefan Walfort in seinem Verriss der zahlreichen Verrisse schreibt: Eine überwiegend »lapidare Vergabe schlagwortartiger Urteile bei Missachtung dessen, was der Primärtext tatsächlich hergibt«, macht die vielstimmige Kritik am Roman Stella kritikwürdig. Dass dabei die Literaturgerichtsbarkeit ihren eigenen Branchenstandards – darunter kulturjournalistische »Basics« wie »detaillierte Analyse« oder »nach bestem Wissen und Gewissen genau lesen« – nicht genüge, kritisiert Walfort besonders scharf. Und in die Rubrik Der letzte Dreck gehöre Stella schon gar nicht.

Takis Würger
Stella
Hanser: München 2019
224 Seiten, 22€
Doch worüber wird im Takis Würger-Prozess eigentlich verhandelt? Wie verhalten sich Angeklagter, Anklage, Verteidigung, Richterstand zueinander? Und wozu diese angestrengte Jura-Analogie überhaupt? Zur Beruhigung vorweg: Sich den Stella-Diskurs als Gerichtsprozess vorzustellen soll keineswegs auf ein larmoyantes »Wer-ist-schon-schuldig«-Schulterzucken à la Würger hinauslaufen, sondern die Zuschreibungsebenen verdeutlichen. Außerdem ist der historische Kontext ein dezidiert verrechtlichter. Walfort fordert eine Stella-Re-lektüre. Diese ermutigt mich zum folgenden Stella-Berufungsverfahren:
Wer wird weswegen angeklagt?
Im Stella-Diskurs finden eigentlich vier Prozesse gleichzeitig statt. Sie voneinander zu trennen mag teils künstlich erscheinen, trägt aber nicht zuletzt Walforts Argumentation Rechnung. In dieser nimmt er vier Anklagen gegen vier Angeklagte in den Blick: Würger als Autor, Stella als Roman, die Erzählinstanz und die Figur Friedrich. Je nachdem, wer oder was auf der Anklagebank sitzt, bringt Walfort mal rezeptions-, mal erzähltextanalytische Mittel zur Verteidigung ein. Das kann mal mehr, mal weniger überzeugen. Gegen den Vorwurf von Bernhard Torsch,1Zit. nach Walfort, Stefan (Torsch, Bernhard: Der letzte Dreck (29). In: Konkret 3. Hamburg 2019, S. 38.) der Autor Takis Würger banalisiere deutsche Jahrhundertverbrechen, wirft Walfort verteidigend ein, er laufe ins Leere, da die »Schuld klar als Täter erkennbarer Figuren […] via vielfältiger Ausdrucksformen deutlich zum Vorschein« komme. Tatsächlich wäre es eine Lektüre gegen den Strich, würde man die Figuren der Täter*innen als schuldlos verstehen. Doch dass selbst augenscheinliches Verbrechen »banalisiert« werden kann, steht nach der Kontroverse um den Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem wohl außer Frage. Auch wer Schuld anerkennt und zuschreibt, kann sie im selben Atemzug banalisieren. So hatte damals die »Verteidigung […] die Strategie [verfolgt], Eichmanns Rolle herunterzuspielen, indem sie ihn als kleines Zahnrädchen in der Mordmaschinerie beschrieb«, obwohl bewiesen worden war, »daß in der Endphase des Kriegs Eichmanns Interesse an einer möglichst vollständigen Vernichtung der Juden zur Obsession geworden war«2Autor*in anonym: Art. Eichmann-Prozess. In: Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Bd. 1. Berlin 1993, S. 391.. Und für Hannah Arendt war Eichmann aufgrund einer »abgrundtiefen Oberflächlichkeit« weniger ein »›Ungeheuer‹, sondern eher ein ›Hanswurst‹«, was sich »in der Formulierung ›Banalität des Bösen‹« niederschlug.3Ludz, Ursula/Wild, Thomas: Einleitung. In: Hannah Arendt/Joachim Fest: Eichmann war von empörender Dummheit. Gespräche und Briefe. München/Zürich 2013, S. 13.
Das war jedoch kein Argument gegen seine Schuld. Gerade der furchtbare Stumpfsinn, von dem sich der Angeklagte nicht befreite, war für Arendt Ausdruck seiner unleugbaren Schuld. Der Vorwurf der Banalisierung von Verbrechen läuft also – will man nicht gegen Arendt argumentieren – zwingend ins Leere. Unangemessen ist er aber auch, weil Würger den Schrecken gerade als Kulisse inszeniert. Das Jahrhundertverbrechen wird funktionalisiert. Banal erscheint hier – und das ist der eigentliche Vorwurf, den schon Torsch hätte ausdrücken sollen – die Schuld.
Walfort gesteht »auch« handwerkliche Versäumnisse seines Mandaten Würger (»schlecht gemacht«) ein. So zeige dieser seine Protagonistin Stella in »ständige[r] Entblößung«. Was die Autorintention betrifft, wiege Würgers Frage, warum die reale Person Stella Goldschlag »weiter Juden jagte, nachdem ihre Eltern vergast worden waren«, schwer. Im NDR-Beitrag Die Geschichte einer jüdischen Kollaborateurin sinniert Würger über »das blonde Gift«: »sie muss auch ganz liebevoll gewesen sein […] sehr zugeneigt dem Leben, und Männern vor allen Dingen […] und gleichzeitig war sie auch ein Monster«
Was kann das Werk für seinen Autor?
Jetzt kann man wie Walfort die Aussagen und Intentionen des Autors für »zweitrangig« halten. Und sicher müssen Lesende »manch fragwürdige Interpretation« nicht nachvollziehen. Es könnte ja gerade ein poetologischer Kniff sein, Lesende anzustoßen, moralischer Fragwürdigkeit eigenständig etwas entgegenzusetzen. Das mag etwa in Fällen launiger Beziehungsromane gelingen. Der Fall des Romans Stella, der vorgibt, nur in Teilen nichtdie Wahrheit über die Shoah zu erzählen, ist anders.
Der Autor Würger attestiert nämlich der realen Person Stella Goldschlag, deren Leben er als Vorlage für seinen Roman ausschlachtet, sie habe sich – als Jüdin in Nazideutschland – im Verrat ihrer jüdischen Mitmenschen an »ihrer Macht berauscht«. Das ist ungeheuerlich, denn Würger schreibt Stella Goldschlag besonders verwerfliche Beweggründe zu. Dies gleicht einer Verurteilung. Dabei blendet er geflissentlich aus, dass Goldschlag immerwährend um ihr Überleben fürchten musste. In diesem Fall ist Würgers Autorintention sicher nicht nur eine Frage der zugrunde gelegten, literaturwissenschaftlichen Rahmentheorie. Denn wie sollen Leerstellen von Lesenden gefüllt werden, wo doch dieser aufs Unangenehmste vereindeutigende, psychologisierende Würger-Zement da ist?
Takis Würger führt weiter aus, ihn »fasziniert […] dieses Böse […] und dieses Schöne« in einer Person – der blonden Jüdin Stella. Eben darüber schreibt er dann, im Reportagestil, garniert mit stalinistischen Aktenfetzen und tiefschürfenden Phrasen des Ich-Erzählers Friedrich: »das Richtige war verloren« oder »Schuld gibt es gar nicht«. Sein Setting ist das Weltkriegs-Berlin 1942: Koks und Jazz, Opernabende und Fliegeralarm. Nazis essen Camembert. Und dann taucht ein wiederholt heraufbeschworener Möbelwagen auf. Er befördert Jüdinnen und Juden in den Tod.
Diesem Stoff ist Takis Würger nicht gewachsen. Vielleicht war der Sprung von seinem Debütroman Der Club (über Männerbünde und Rudern) zu einem Shoah-Roman, nun ja, ambitioniert. Und vielleicht machen selbst ein Hanser-Verleger und Würgers »Mama«, »die beste Lektorin der Welt«, wie er sie uns in seiner Dankeslaudation am Ende von Stella präsentiert, aus einer ambitionierten Intention noch längst kein gelungenes Werk. Man fühlt sich fast dazu hingerissen, den Roman für seinen Autor zu bedauern.
Und was können die Figuren schon für ihren Autor?
Wie Würger Stella schreibt, kann man unangemessen, großartig-mutig, belanglos, effekthascherisch oder sonst wie finden. Würger wartet allemal mit einem gruselig-erotischen, Netflix-tauglichen Unterhaltungssound auf. Auch an einer ordentlichen Prise Babylon Berlin und also den Roaring Twenties spart er keineswegs. Da sollten natürlich auch die Figuren schillern. Bei Stella bedient sich Würger der Zuschreibungen, die ihn so in den Bann ziehen, und wohl überhaupt erst zum Schreiben des Romans brachten: blond, kaltblütig, schön, jüdisch, böse, lieb. Und eben häufig nackt. An ihre Seite setzt er Friedrich.
Würger hat diesen Friedrich, der uns überdies exklusiv die Geschichte erzählt, zu einer eigenartigen Figur gemacht. Und hier ist Walforts Kritik an feuilletonistisch irrlichternden Interpretationen zuzustimmen: Friedrich als moralisch »unschuldiger Schweizer«4Zit. nach Walfort, Stefan (Antonia Baum, …) Antagonist Stellas zu lesen, ist unhaltbar. Walfort hält das insofern für eine verfehlte Lesart, da ein narratologischer Trick übersehen werde: Friedrich wirke nur unschuldig (»Primacy-Effekt«), wobei er tatsächlich die Figur Tristan von Appen ans Messer liefere. Walfort speist die These über den Verrat allein aus dem Epilog.
Auf den knapp vier Seiten vermengt Würger auf besonders abenteuerliche und intransparente Weise Historisches (etwa den Suizid Stella Goldschlags 1992) und allerlei Fiktionales (»anonymer Anrufer aus dem Ausland« 1942). Erst dieser telefonische Hinweis Friedrichs, wie Walfort meint, an die Nazis, infolgedessen sie ihren SS-Kollegen von Appen aufzusuchen, mache Friedrich aufgrund seines »vergleichsweise erbärmlichen» Motivs, Walfort vermutet Eifersucht, vergleichsweise schuldig.
Was ist der Autor seinem Erzähler schuldig?
Würgers Ich-Erzähler wird aber keineswegs als Unschuld vom Lande »geprimt«. Friedrich bewirft einen fremden Kutscher mit Schneebällen, nimmt alkoholgeschwängerte und antisemitische und alkoholgeschwängerte Ausfälle seiner Mutter hin, reist als voyeuristischer Kriegstourist nach Nazideutschland, befördert Stellas Drogenabhängigkeit, setzt sein unerschöpfliches Vermögen für illegalen Kaviar und »Schampus« statt für Hilfsbedürftige ein, feiert mit seinem SS-Kumpel. Gerade von einer Nazi-Weihnachtsfeier zurück schmeißt er zum Abschied Stellas Dienstrevolver in die Spree. »Du hättest die Wände unseres Hauses bunt gestrichen«, phantasiert der farbenblinde Friedrich im Zug, als er Berlin verlässt. Ob das Verschwinden der Waffe Stellas die Nazischergen zu ebenso lieblichen Tagträumen anregt, ist unwahrscheinlich. Vielmehr ist zu vermuten, dass die Erklärungsnot, in die sie dadurch gerät, ihre Leben zusätzlich gefährdet.
Die Erzählperspektive ist jedoch nicht etwa zweifelhaft, weil Friedrich eigenartige Dinge macht. Entscheidend ist: Würger lässt seinen Erzähler nur Schwarz und Weiß sehen. Und verstummen. Was Friedrich in Handlungsszenen macht, ist häufig: Nichts. Manche mögen gerade darin die erzähltechnische Stärke Stellas sehen. Mündige Lesende bräuchten ja keinen antiken Chor, der sie mit Trigger-Warnungen und einem moralischen Kompass versorgt oder ähnlich kommentierend eingreifende Instanzen.
Wer aber über die Shoah schreibt, weiß um berechtigte Frage, ob dies ihr oder ihm gelingt. Die Shoah ist nun mal »kein Stoff wie jeder andere«.5Strümpel, Jan: Im Sog der Erinnerungskultur. Holocaust und Literatur – ›Normalität‹ und ihre Grenzen. In: Text + Kritik, H. 144 (1999), S. 11. Seit es das Genre der Shoah-Literatur gibt, existieren große Vorbehalte gegenüber der Fiktionalisierung des Themas überhaupt und gegenüber unsensiblen und »›unangemessenen‹«6Ebd., S. 14. Formen erst recht. Ein arg übers Knie gebrochener Erzähler befördert das Gelingen wohl kaum. Nicht etwa, weil er als urteilende Instanz ausfällt, sondern weil er genaues Hinsehen und Hinhören verhindert. Friedrich ist als Figur unzuverlässig, und als Erzähler auch. Im Kracht’schen Faserland ist so ein unzuverlässiger Erzähler genau richtig aufgehoben. Dort sorgt er für ein popliteraturtypisches, fahriges Irritiert-Sein. Eine in Teilen dezidiert wahre Geschichte zur Judenvernichtung einem Erzähler anzuvertrauen, auf den kein Verlass ist, erscheint hingegen einigermaßen verwegen. Tatsächlich verschwimmen in Stella »Liebe«, »Seidenkleider«, »Judenhass«, »Jatz« und »Schuld« zu einem rauschenden Einerlei.
Lässt Würger seinen Erzähler sagen, was er will?
Natürlich erschöpft sich weder der Autor im Erzähler noch der Erzähler in der erzählenden Figur. Und wenn der Erzähler ausgiebig den Menschenhass der Figuren wiedergibt, affirmiert der Autor damit natürlichnicht per se das Gesagte. Ein Folterer setzt gegenüber Friedrich Juden mit Unkraut gleich, der Kinderbuchautor Ernst Hiemer Juden mit Giftpilzen, und von Appen schwadroniert von »verjudetem Charakter«. Und was steht im Roman über Stellas Verhalten? Sie fühlt sich zu Tristan hingezogen, bewundert den Nazi-Autor, tanzt mit ihm, singt auf Nazi-Festen.
Würgers Friedrich räsoniert dazu: »Stella war in diesem Moment dort, wo sie sein wollte.« Gegenüber dem NDR wird Würger nicht müde, zu betonen, aus »Akten» gehe hervor, Stella Goldschlag habe im »schwarzen Mantel der Gestapo […] Juden gejagt« und legt seinem Erzähler in den Mund: »So ist sie nicht wirklich, hatte ich gedacht, als sie mit ihrem Ledermantel in die Stadt gegangen war. Nun verstand ich, dass sie auch so war.« Dass Stella, immerwährender Lebensgefahr ausgesetzt, nicht auch noch den Ausschluss von ihrem kulturellen Leben hinnehmen wollte, scheint für Würgers Friedrich unerhört.
Zwei Sachverhalte erschweren es dabei besonders, Autor, Erzähler und Figur nicht gleichzusetzen. Natürlich gehören Autor und Erzähler unterschiedlichen Generationen an und dennoch scheint ihre Weltsicht weniger zu trennen, als ein paar Jahrzehnte Altersunterschied vermuten lassen. Im bereits erwähnten NDR-Beitrag betont Würger: »Stella hat verächtlich auf die sogenannten Ostjuden geguckt«. Als Quelle dient ihm wohl die im Roman angegebene Stella-Biografie von Peter Wyden.7Wyden, Peter: Stella Goldschlag. Eine wahre Geschichte. Steidl 2019, bes. S. 21–25. Dieses Buch und antisemitische Stereotypen, Topoi, Figurenkonfigurationen sowie intertextuelle Bezüge in Stella bedürfen eigentlich einer umfangreichen Auseinandersetzung. Fest steht allerdings: den Antisemitismus der Nazi-Figuren ausgiebig auszubuchstabieren ist das Eine. Stella (und ihrer Familie) Antisemitismus zuzuschreiben das Andere. Nicht erst beides zusammen ist, gelinde gesagt, eine ziemliche Herausforderung. Denn Stellas Taten werden isoliert herausgestellt und moralisch beleuchtet, während die Verbrechen Nazideutschlands zur Staffage verkommen.
Vergeht sich der Autor am historischen Stoff?
Zur Ausstaffierung des Settings lässt Würger Nazideutschland zwar aufleben, als rechtlich-ethische Hintergrundfolie spielt es keine Rolle. Jetzt kann man jubilieren: Toll, genau fürs Skandalös-Brisante ist Kunst da! Oder man schaut auch hier genauer hin. Takis Würger hat an 14 Stellen in kursiver Schrift insgesamt 16 undatierte Fälle einstreut. Dabei handele es sich, so Würger, um »Feststellungen eines sowjetischen Militärtribunals«. Was er verschweigt: das sind keinesfalls rechtstaatlich abgesicherte Fakten, sondern Ausschnitte aus Polizeiakten. »[D]as Militärtribunal hat in dem Verfahren am 31. Mai 1946 keinen einzigen Zeugen vernommen«, es handelte sich um »eine stalinistische Aburteilung binnen fünf Minuten«, gibt der Rechtsanwalt Karl Alich zu bedenken.
Alich wurde von Birgit Kroh, der Inhaberin Goldschlags publizistischer Persönlichkeitsrechte, mit dem Schutz derer postmortalen Persönlichkeitsrechte betraut. Die von Würger (nicht vom Erzähler) eingestreuten Aktenstellen hatten Folgen: Goldschlag wurde auf ihrer Grundlage im Eilverfahren verurteilt und saß – im Gegensatz zu dem allergrößten Teil der Nazi-Verbrecher*innen – für das, was ihr zur Last gelegt wurde, im Gefängnis, zehn Jahre lang. Für Rechtsanwalt Alich bedeutet Würgers »bruchstückhaftes Zitieren« »ehrverletzende[r] Tatsachen ohne Erklärung«, er lasse als »Autor einen verantwortungsvollen Umgang mit den Informationen über Stella Goldschlag vermissen«.
Und wie endet dieser Würger-Prozess?
Damit sind wir wieder beim Autor. Mit ihmes an. Das war der erste Prozess. Dass Leute den Autor Takis Würger, seinen Roman, Friedrich als Erzähler und vielleicht auch die Figur der Stella lobenswert finden, ist natürlich okay. Dass er von seiner Faszination für das gleichzeitig »Böse« und »Schöne« angetriebenen einen Roman über 1942-Nazideutschland schreiben wollte, macht Takis Würger als Autor, um im Sprachgebrauch der Juristerei zu bleiben, noch nicht schuldig. Es ist natürlich seine künstlerische Freiheit. Denn zum Glück gibt es keine literarisch-moralische Polizei und dieser Würger-Prozess entspringt, ganz so wie der Schweizer Bub Friedrich oder der Nazi-Taxifahrer, einem Reich der Fantasie. Dabei macht schlecht gemachte Kritik an Stella diesen Roman allerdings nicht per se weniger schlecht. Vielleicht führt die juristische Auseinandersetzung nicht zum Schutz des Andenkens Stella Goldschlags, sondern sogar zur Steigerung Stellas kommerziellen Erfolgs. Während sich echte Urteilsfindung also im Instanzenzug erschöpft, kann über Literatur, zum Glück, ewig prozessiert werden.
So steht es einem also frei, diese Motivation und Autorintention bedenklich zu finden und sein Können zweifelhaft. Das ist und bleibt einleuchtend, denn sein Roman und sein Erzähler können natürlich nichts für ihren Autor – und am allerwenigsten Stella Goldschlag, deren Leben für den Roman Stella herhalten muss. Diese Prozesse müssen eingestellt werden. Auf der literaturkritischen Anklagebank sind sie fehl am Platz. Wer für sie allerdings herhalten muss, ist ihr Erfinder. Sie sind Zeugnisse ihres Autors. Als solche belasten sie Takis Würger als moralisch integren Künstler.
Ob Würger mit seinem Roman Goldschlags Persönlichkeitsrechte verletzt, darüber werden natürlich echte Gerichte urteilen. Dass sein Erzähler Friedrich dem historischen Stoff angemessen ausstattet und dass er als Autor selbst dem Stoff gerecht wird, wurde an dieser Stelle literaturkritisch in Zweifel gezogen.


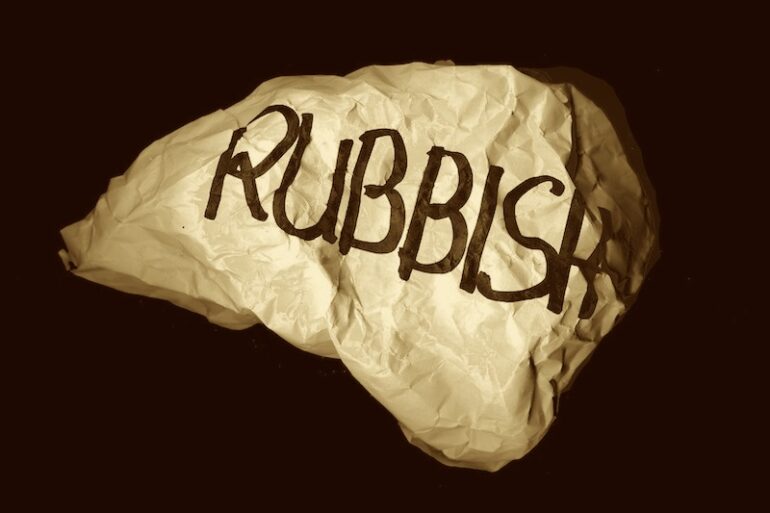




Sehr geehrter Herr Wittenstein,
ich danke Takis Würger, dass er mich dazu gebracht hat, mein Buch über
Stella: “Freispruch für Stella Goldschlag” zu schreiben. Ich wollte nicht nur
meckern, ich will es besser machen. Ich wünsche mir von Ihnen auch eine
so gnadenlos treffende Rezension.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Alich